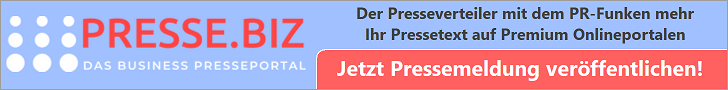Wenn es Start-ups ins Ausland zieht, stellt dies einen Verlust für den Innovationsstandort Deutschland dar. Denn mit den Start-ups wandert auch Knowhow und zukünftiges Innovations- und Beschäftigungspotenzial ab. Zwar scheint sich das Problem in Grenzen zu halten.
In einer Umfrage unter Venture Capital-Gesellschaften mit Sitz in Deutschland hatten von 30 befragten VC-Investoren nur sechs abgewanderte oder abwanderungswillige Start-ups in ihren Portfolios. Im Allgemeinen können die Abwanderungsgründe deutscher Start-ups aber vielfältig sein.
Bessere Finanzierungs- und Exit-Möglichkeiten bedeutendste Gründe Deutschland blickt im Zuge des internationalen VC-Booms auf ein Rekordjahr beim Investitionsvolumen zurück. Die VC-Märkte etwa in den USA oder UK bleiben dem hiesigen Markt jedoch nach wie vor weit voraus. Wichtigster Grund für die Abwanderung deutscher Start-ups sind daher die besseren Finanzierungsmöglichkeiten im Ausland (siehe Grafik).
Bessere Exit-Möglichkeiten, also Trade-sales an ausländische Unternehmen oder IPOs an Börsen im
Ausland, sind aus Sicht der VC-Gesellschaften der zweitwichtigste Abwanderungsgrund. Auch die Aussicht auf ein besseres Bewertungsniveau in weiteren Finanzierungsrunden erscheint als wichtiger Anreiz für den Schritt ins Ausland. Insbesondere in den USA werden je Finanzierungsrunde im Schnitt größere Volumen investiert als hier zu Lande.
Schließlich sind in vielen Finanzierungsrunden deutscher Start-ups, insbesondere bei solchen mit größerem Volumen, Investoren aus dem Ausland beteiligt. Somit spielt häufig auch der direkte Wunsch ausländischer Investoren nach einer Verlegung des Unternehmenssitzes eine entscheidende Rolle. Zugang zu internationalen Märkten wichtig – Fachkräftegewinnung selten entscheidend.
Neben Aspekten des Finanzierungsumfeldes sind die Aussicht auf ein besseres technologisches Umfeld und die Erschließung internationaler Märkte wichtige Beweggründe für die Orientierung ins Ausland. Die Anbahnung strategischer Partnerschaften erscheint dagegen weniger relevant.
Oft gelten eingeschränktere Möglichkeiten für Mitarbeiterkapitalbeteiligungen oder etwa Hürden durch das geltende Einwanderungsrecht als deutsche Standortnachteile. Zudem ist hier zu Lande seit einigen Jahren in vielen technischen Berufen ein Fachkräfteengpass zu konstatieren. Die Mitarbeitergewinnung aus dem Ausland sowie ein mangelnder Zugang zu Fachkräften werden jedoch erst im Mittelfeld der Abwanderungsmotive genannt.
Regulatorische und administrative Hürden häufig nachrangig. Auch ein zu langwieriger und komplizierter Beteiligungsprozess findet sich in der Mitte der Abwanderungsmotive. Vorteilhaftere rechtliche Rahmenbedingungen im Ausland oder Einschränkungen durch die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind hingegen selten ein Abwanderungsgrund. Auch die leichtere Akquise staatlicher Aufträge aus dem Ausland ist ein untergeordneter Beweggrund für eine Verlagerung des Unternehmenssitzes.
Gerade bei der raschen Skalierung von Geschäftsmodellen gilt die Größe der Heimatmärkte als Vorteil etwa chinesischer oder US-amerikanischer Unternehmen. Die Fragmentierung des EU-Binnenmarktes durch regulatorische oder sprachliche Barrieren rangiert unter den Abwanderungsgründen jedoch in der unteren Hälfte.
Insgesamt zeigt sich also, dass das Finanzierungsumfeld ein bedeutender Faktor bei der Standortwahl ist. Damit Start-ups erst gar nicht über eine Abwanderung nachdenken müssen, sollten durch den Ausbau des deutschen VC-Ökosystems die wichtigsten Abwanderungsgründe adressiert werden.
(KfW)